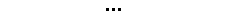Kleinkunst Straßentheater Kabarett Variete Circus
Agenturen Wettbewerbe Comedy Galas Festivals
- Titelstory [81 Artikel]
- Szenen Regionen [1142 Artikel]
- News Events [880 Artikel]
- Preise | Ausschreibungen [227 Artikel]
- Themen-Fokus [881 Artikel]
- Services | Tipps [142 Artikel]
- Bücher | CDs | Software [234 Artikel]
Szenen Regionen :: Frankreich
[zurück]
Jongleure der Identität
Bin ich Mann, bin ich Frau? Ob femme à barbe oder transsexuell, sie spielen mit der Definition der Geschlechter und gehen neue Wege in Cabaret, Musical und Performance. Und sie haben ihre Wurzeln im Zirkus oder in der Straßenkunst, angefangen bei Jeanne Mordoj. Deren „Eloge du poil“ (Loblied auf die Körperhaare) ist nur oberhalb des Halses eine haarige Angelegenheit. Da nämlich klebt sich Mordoj eine Art Kapitänsbart ins Gesicht. Den entdecken wir aber erst später, denn am Anfang der Aufführung sieht man sie von hinten, den Kopf verhüllt und orientalisch-sinnlich anmutend. Umso verstörender ist es dann, ihr männliches Attribut zu entdecken. Der Kontrast rüttelt an tiefen, verdrängten Zweifeln, an unseren erworbenen Mustern geschlechtlicher Identität. Jeanne erzählt, wie sie einmal nach einer Probe in die Kneipe ging, ohne vorher den Bart abzunehmen. „Die Reaktionen waren unglaublich aggressiv, von Männern und Frauen! Aber niemand kam auf die Idee, dass der Bart nur angeklebt sein könnte. Woher rühren diese Ängste, die sich an ein paar Haaren entzünden?“' Und auch im Theater reagiert man als Zuschauer aus dem Bauch heraus, obwohl man doch weiß, was einen erwartet. Aber es geht hier um viel mehr. Die Haare stehen für alles Unsaubere, Ungeglättete, alles, was die Gesellschaft unter ihre blankpolierte Oberfläche kehrt. Und Mordoj arbeitete bereits mit Kompanien wie La Salamandre und Cahin Caha, also im Straßentheater und im Zirkus. Jetzt hat sie sich ihr eigenes Theater gebaut, in dem die Zuschauer wie um einen Laufsteg herum sitzen. Auf dem zeigt Jeanne ihr Talent, zwischen Attraktion und Abstraktion den Weg zur Emotion zu gehen. In manchen ihrer Bilder spiegelt sich ihre Forschungsreise zu den echten Bart-Frauen in Osteuropa. In anderen jongliert sie mit Muscheln, schwingt sich in die Poesie der Vögel oder lässt ein Eidotter über ihren Körper gleiten. Solche Jonglage geht einem direkt unter die Haut. Oder die Bart-Frau verschwindet gleich im Erdreich, um sich der Verwesung preiszugeben. Fruchtbarkeit und Tod durchziehen Mordojs Symbolik. In Sachen Charakter und Ausdrucksstärke wäre sie am ehesten mit Ilka Schönbein zu vergleichen. Auch Mordoj ist zugleich Tänzerin und Puppenspielerin, und dazu noch Bauchrednerin. Als solche führt sie einen absurden Dialog mit Totenschädeln von Widder und Wiesel, oder sie lässt gar einen ganzen Gruft-Chor aus Tierschädeln zu deutschen Frühlingsliedern tanzen (www.elogedupoil.com).
Dagegen ist ein Mann im Frauenkleid fast schon banal. Philippe Ménard hat beschlossen, dass er in zwei Jahren auch körperlich eine Frau sein wird. Bis zur Operation bleibt also noch etwas Zeit, ihm dabei zuzuschauen, wie er sein Trauma zu seinem Traum macht. Nach der Operation wird er nämlich keinen Grund haben, „P.P.P.“ weiter aufzuführen. Das Kürzel steht für „Position parallèle au plancher“, für das Liegen also, und vielleicht gar für den Tod. Einem (kalkulierten) Risiko setzt sich Ménard in der Tat aus. Immer wieder fallen Eiskugeln wie Bomben von der Decke herab und zerbersten mit lautem Krachen. Eis ist das visuelle und taktile Medium von „P.P.P.“ Es geht um Kälte, Härte und Schmerz. Ménards Kleid friert am Eisblock fest, und beinahe auch seine Hände an den Eisbällen, mit denen er zu jonglieren versucht. Zu den unterschwelligen Themen gehört das Unkontrollierbare. Wer kann schon mit schmelzendem Eis so sauber jonglieren wie mit griffigen Bällen? So spielt Ménard auch mal Torwart oder schaufelt kreisförmige Eislandschaften, legt sich aufs Eisbett oder jongliert mit einem Schlachterbeil. Und immer wieder setzt es Eisbombeneinschläge ganz in seiner Nähe. Die sind zwar antizipiert, aber er kontrolliert sie nicht. Doch am wichtigsten bleibt, dass er dabei BH und Frauenkleider trägt, aus rotem Samt zum Beispiel. So werden Härte und Kälte des Eises zu einer Metapher der männlichen Welt und das Stück zu einem surrealistischen Ritual. Wärme bringt das Eis zum Schmelzen und ins Fließen. Das ist wie mit Yin und Yang. Nach der Aufführung schließt Ménard gern eine Diskussion mit dem Publikum an. Da erzählt er von seinen Recherchen zu männlichen und weiblichen Gemütszuständen und wie ihm die männlichen Empfindungen von seinem Vater aufgezwungen wurden. Ach, wenn doch alle engagierten Künstler so feinfühlig arbeiteten (www.philippemenard.com)!
Nicht nur die Interpreten spielen mit Ihrer Identität. Auch Frankreichs Zirkus besetzt immer stärker die Grenzfelder. So ist es unmöglich, „Eloge du poil“ einer Kategorie zuzuordnen und Philippe Ménard versteht sich längst nicht mehr als Jongleur, sondern als Performer. Trotzdem stand „P.P.P.“ im Festival „Des auteurs, des cirques“ in La Villette (Paris) im Programm, genauso wie „Warm“, eine Inszenierung von David Bobee. Auch er stellt klar, dass er Theater macht und nicht Zirkus. Körpertheater muss das dann wohl sein. Der Titel rührt daher, dass zu Beginn der vierzig Minuten auf der Bühne die Heizung anspringt, wo es schnell 45° C warm wird. Die nackten Oberkörper von Alexandre Fray und Frédéric Arsenault spiegeln sich in der Rückwand und sind in Schweiß gebadet, wenn sie sich aufeinanderwerfen. Dazu haucht und stammelt die Schauspielerin Virginie Vaillant einen Text von Ronan Chéneau ins Mikrofon, als wäre sie hier eine Art Ringrichterin. Doch meist geht es um erotische und sexuelle Ausrufe und Wünsche. Dabei steht die wachsende Erschöpfung der sich verausgabenden Akrobaten im Widerspruch zum Höhenflug der erotischen Bilder. Über die Temperatur, die selbst den Saal gehörig aufheizt, macht auch das Publikum in „Warm“ eine körperliche Erfahrung. Ob diese Form von Rohschliff-Akrobatik nun allein von Anstrengung erzählt oder doch erotisch ist, oder gar homoerotisch, dazu entwickeln sich nach der Aufführung engagierte Diskussionen. Auch dem Text, der eigentlich eine weibliche Fantasie beschreibt, ist das nicht eindeutig zu entnehmen (www.rictus-davidbobee.net).
Wer bin ich, das fragt sich auch der Ganove Nestor in „Irma la douce“, der sich immer wieder in den eleganten Monsieur Oscar verwandelt und dabei zum zahlenden Freier seiner eigenen Braut wird, die das Doppelspiel nicht bemerkt. Bis Nestor als Oscars Mörder im Zuchthaus landet, dort ausbricht, nach Montmartre und zu Irma zurückkehrt und Oscar wieder aufleben lässt, nur um mit ihm endgültig Schluss zu machen. Eine neue Bearbeitung von Alexandre Brefforts berühmter Komödie bietet die Kompanie Les’Armuzes. Da ist, mit Bezug auf Brefforts eigene, aber kaum bekannte Theaterfassung, die Handlung auf Irma, Nestor/Oscar und Bob le Hotu reduziert. Es wird von Anfang bis Ende gesungen und das Trio, angeführt von Sophie Plattner, sprüht vor Esprit und Energie. Einziger musikalischer Begleiter ist das Akkordeon. Doch alle Folklore weicht dem galoppierenden Rhythmus. Plattner spielt nicht nur Irma, sondern ist auch Regisseurin und zeichnet verantwortlich für die sehr schlichte, zeitgemäße Bearbeitung. Und am Ende drehen sie es so, dass Irma sich in Nestor verwandelt und der Gauner selbst zum Freudenmädchen wird (www.irmaladouce.fr).
Damit ist der Sommer in Paris dann auch vorbei, und man darf schon an den nächsten denken. Was tun, wenn man vor oder nach den Festivals in der Provence einen Halt am Eiffelturm einlegt? Dass für Paris Plage ein paar Liegestühle am Seine-Ufer aufgestellt werden, das weiß die ganze Welt und die drängelt sich auch dort, wenn denn mal die Sonne scheint. Paris Plage bietet sogar ein paar Konzerte, aber ein Kulturangebot ist das nicht. Cleverer ist, wer sich das Programm von Paris Quartier d’été (PQE) ansieht. Das Sommerfestival wurde gerade zwanzig Jahre alt und ist immer noch frisch wie am ersten Tag. Ein exzellentes, internationales Programm spiegelt den aktuellen Stand der Kreation in Tanz, Musik, Performance, Zirkus etc. Da verbreiten sich Weltmusikkonzerte, umsonst und draußen, vom Zentrum bis in die Banlieue. Oder man besucht Pierre Henry in dessen Haus. Die „Konzerte“ im Wohnzimmer des Mitbegründers der konkreten Musik sind ein Ritual des Festivals. Überhaupt besteht dessen Charme darin, dass dank PQE selbst Pariser ungewöhnliche, ihnen verborgene Orte in und um die Seinestadt entdecken. Direkt am Kanal, zwischen Paris und Saint-Denis, stand die Baracke von La Volière Dromesko. Die Truppe um den rauen Igor verzückte uns lange Jahre mit poetisch-spielerischen Produktionen, in denen Geier oder Schuhschnabel frei umherwandelten. Doch aus der Voliere wurde eine banale Baracke. Igor ist sanft geworden. Oder ist er nur müde? Der Geier ist noch dabei, doch er wirkt genauso schlaff wie die Musiker und die Kalauer der Truppe. Beim Festival können sie dafür nichts. Und Igor sollte mal zu Jeanne Mordoj gehen, da würde er wieder aufwachen (www.quartierdete.com).
Redaktion: Thomas Hahn